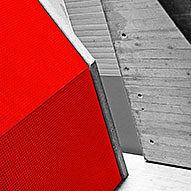17.04.2024 | UR eröffnet digitales Lehr-Lernlabor „DigiLabUR“
16.04.2024 | Duties of Civility?
15.04.2024 | Die Universität Regensburg wird das dritte Mal in Folge als „Fairtrade-University“ ausgezeichnet
12.04.2024 | Erste Auswahlgespräche für den Medizin-Studiengang „MedizinCampus Niederbayern“
02.04.2024 | Hidden Patterns