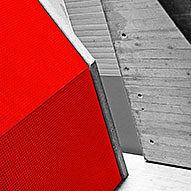Über die Region mit der Region
seeFField - Neues Projekt der Regensburger Area Studies - Förderung durch VolkswagenStiftung – Podiumsdiskussion und Impulsvortrag zu Südosteuropastudien und „Westbalkan-Sechs“
19. Oktober 2022
Die Südosteuropa-Studien in Regensburg stärken und deren Interdisziplinarität noch fruchtbarer machen, dies eingebettet in den innovativen Regensburger Forschungsansatz der multiskalaren Area Studies: So beschrieb Projektleiter Dr. Ger Duijzings, Professor für Sozialanthropologie mit Schwerpunkt Südost- und Osteuropa, das von der Volkswagen-Stiftung und der Universität Regensburg geförderte Projekt seeFField. Dessen Kick-off bildete ein Podiumsgespräch mit Südosteuropa-Expert:innen am 17. Oktober 2022 im Vielberth-Gebäude der Universität Regensburg (UR) zur Bedeutung und Herausforderung von Südosteuropastudien.
Der Diskussion ging ein Impulsvortrag des Sondergesandten der Bundesregierung für die Länder des westlichen Balkans und Präsidenten der Südosteuropa-Gesellschaft, Manuel Sarrazin, voraus. Universitätspräsident Professor Dr. Udo Hebel beschrieb das Projekt zu Beginn der Veranstaltung als Verdichtung der jahrelangen strategischen Ausrichtung der Universität Regensburg in Sachen Ost- und Südosteuropaforschung. Der Erfolg des Projektantrages, so der Universitätspräsident, spiegle die Wahrnehmung ausgezeichneter Forschung am Standort Regensburg, mit dem Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung (IOS) und dem Leibniz-WissenschaftsCampus, einer gemeinsamen Einrichtung von IOS und Universität Regensburg.
Über den Zwischenstand des Centers for International and Transnational Area Studies (CITAS) sei man nun beim DIMAS angekommen, dem Department für Interdisziplinäre und Multiskalare Area Studies. So entstehe eine besondere, querschnittsthemenorientierte Department-Struktur, erläuterte Universitätspräsident Hebel. Die Forschung in dieser neuartigen Konstruktion stärkten sechs integrierte Professuren aus der Hightech-Agenda Bayern. Deren Denominationen ergänzen die „herkömmlichen“ Fächer – sie behandeln Themen wie die räumlichen Dimensionen kultureller Prozesse oder transregionale Normentwicklung.
 Bei der seeFField-Eröffnungsveranstaltung mit Universitätspräsident Prof. Dr. Udo Hebel. Fotos: Katharina Herkommer/UR
Bei der seeFField-Eröffnungsveranstaltung mit Universitätspräsident Prof. Dr. Udo Hebel. Fotos: Katharina Herkommer/UR
Mobilisierung regionalen Wissens
seeFField bringt vorrangig drei Disziplinen zusammen: Geschichte, Linguistik, Sozialanthropologie. Professor Dr. Ger Duijzings gab einen kurzen Projekt-Einblick: Von 2022 bis 2029 werden 18 Partnerinstitutionen (15 davon internationale) mit Regensburg als Verknüpfungs- und Knotenpunkt in vielerlei Hinsicht zusammenwirken, etwa in gemeinsamen akademischen Veranstaltungen und einer digitalen Forschungs- und Lehrplattform. Für Studierende der Südosteuropastudien entstehen zusätzliche Lehrangebote im Bereich konzeptueller und methodologischer Ansätze in den Area Studies, außerdem wird ein Albanisch-Lektorat eingerichtet.
Wissenstransfer ist dabei ein wichtiger Baustein – ein studentischer Blog will die Kommunikationsfähigkeit der Studierenden weiterentwickeln, Wissen mit der nicht-akademischen Welt und damit der breiten Öffentlichkeit zu teilen ist ein erklärtes Ziel des Projektteams. Dies soll insbesondere auch vor Ort passieren – ein besonders Moment sei die „Mobilisierung regionalen Wissens“, erläuterte Duijzings. seeFField will sich in den kommenden sieben Jahren besonders mit und bei den Akteur:innen in der ganzen Region Südosteuropa engagieren, die Journalist:innen vor Ort einbeziehen, dort Events organisieren und internationale Early Career Researcher hier wie dort zu Wort kommen lassen.
Die Westbalkan-Sechs und die EU
Südosteuropa als Region bietet aus Sicht der Projektverantwortlichen ein hervorragendes Beispiel für unterschiedliche globale und überregionale Verbindungen, die mit dem europäischen Projekt konkurrieren (oder dieses bedrohen).
Vor diesem Hintergrund gab  Manuel Sarrazin (l.) in seinem Impulsvortrag Hinweise zu Prioritäten deutscher Außer- und Sicherheitspolitik in Sachen „Westbalkan-Sechs“. In seinen Ausführungen verweist er auf einen für 3. November 2022 geplanten nächsten Gipfel des Berlin-Prozesses, mit dem ein entscheidender Schritt vorwärts in Sachen Integration der Westbalkan-Staaten in die Europäische Union geplant sei. „Wir stricken an grüner Agenda und gemeinsamem Markt; wir wollen Mobilitätsabkommen vereinbaren und in den Bereichen Jugendkultur und Cybersicherheit stärker tätig werden“, berichtet Sarrazin.„Deutsches Gewicht“ solle sich hier einsetzen bei den Dingen, die lange nicht vorankamen, so der Redner, und Chancen genutzt werden: „Die Zeiten sind so ernst, dass nicht mehr viele Chancen auf der Straße liegen…“. Sarrazin will, „dass wir wieder zusammenkommen und Deutschland und EU an einem Strang ziehen.“
Manuel Sarrazin (l.) in seinem Impulsvortrag Hinweise zu Prioritäten deutscher Außer- und Sicherheitspolitik in Sachen „Westbalkan-Sechs“. In seinen Ausführungen verweist er auf einen für 3. November 2022 geplanten nächsten Gipfel des Berlin-Prozesses, mit dem ein entscheidender Schritt vorwärts in Sachen Integration der Westbalkan-Staaten in die Europäische Union geplant sei. „Wir stricken an grüner Agenda und gemeinsamem Markt; wir wollen Mobilitätsabkommen vereinbaren und in den Bereichen Jugendkultur und Cybersicherheit stärker tätig werden“, berichtet Sarrazin.„Deutsches Gewicht“ solle sich hier einsetzen bei den Dingen, die lange nicht vorankamen, so der Redner, und Chancen genutzt werden: „Die Zeiten sind so ernst, dass nicht mehr viele Chancen auf der Straße liegen…“. Sarrazin will, „dass wir wieder zusammenkommen und Deutschland und EU an einem Strang ziehen.“
Die Idee: alle sechs Westbalkan-Staaten in der Region gleich zu behandeln und regionale Integration zu erreichen, mit dem Ziel der Angleichung der Rechtsstandstandards. Als Freund von Robert Schuman gehe es ihm um die „Solidarität der Tat“, betont der Redner. Schaffe die EU jetzt nicht, die Glaubwürdigkeit des Prozesses hinzubekommen, sei es zu spät. „Wir sind nicht mehr so sexy wie vor 10 Jahren… Wir müssen liefern.“ Zudem habe es viele negative Entwicklungen gegeben, der Druck auf die Akteur:innen des Diskurses – in Deutschland wie in der EU - sei stärker geworden. Die EU-Erweiterung früherer Jahre? So werde es auf dem Westbalkan nicht funktionieren, sagt Sarrazin. Man müsse über Veränderungen in der Zivilgesellschaft sprechen, die Interaktion von Akteuren verändern, um „ein pro-europäisches Mindset“ zu schaffen. Insbesondere Deutschland dürfe nicht aufhören, an die EU-Erweiterung zu glauben, fordert Sarrazin. Weitsicht und Klarheit wie zu Zeiten der deutschen Wiedervereinigung kann er derzeit nicht mehr erkennen: „Diese strategische Weite fehlt mir bei Blick auf die Staaten des westlichen Balkans. Nicht nur dort, auch bei uns.“
Südosteuropa und Regensburger Area Studies
Im Anschluss an Sarrazins Gedanken will Moderator Dr. Andreas Ernst von der Auslandredaktion der Neuen Zürcher Zeitung von den Expert:innen auf dem Podium mehr über die Herausforderungen wissen, die im Umgang mit Südosteuropa und dessen Erforschung auftauchen. Die erste Frage geht an Dr. Vera Szöllösi-Brenig, Mitglied im Förderteam „Wissen über Wissen" der VolkswagenStiftung: „Was wir bisher problemlos die Region nennen, ist eine heikle Region geworden. War das ein Grund, dass Sie so viel Geld ausgeben für deren Erforschung?“ Förderung, sagt Szöllösi, habe mit Krisen nichts zu tun. Man könne sich schlicht nicht leisten, einzelne Sparten von Wissen ab- oder anzuschalten. Das Programm „Weltwissen – Strukturelle Stärkung kleiner Fächer“ der VolkswagenStiftung fördere bewusst kleine Fächer und prekäres Wissen. Zudem blicke man auf die Eingliederung des Projektes in die Universität und seine Integration vor Ort. „Das UR-Projekt war das einzige Projekt in den Area Studies, das erfolgreich war,“ berichtet die Referentin, begleitet von freudigem Applaus.
Ein Grund dafür sei die Tatsache, dass im Regensburger Antrag auch Sprache und Sprachkompetenz eine Rolle spielten. Slavist Professor Dr. Björn Hansen wird später darauf hinweisen, dass linguistische Kenntnisse die Möglichkeit bieten, „Diskurse in den Ländern zu verstehen, ebenso die Konflikte, die dahinterstehen“. Können Sprachen Regionen konstituieren, will Andreas Ernst von ihm wissen, müssen sie vielleicht sogar? Linguistisch lasse sich ein Areal festlegen, sagt Sprachwissenschaftler Hansen, „aber wenn man sich Diskurse ansieht, sind diese transnational.“
Von transnationalen und transregionalen Ansätzen berichtet auch Dr. Marie-Janine Calic, Professorin für Ost- und Südosteuropäische Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Von ihr will Andreas Ernst wissen, was Südosteuropa eigentlich zur Region mache: „Fremdzuschreibung? Muss es eine Region für sich sein, mit regionalem Bewusstsein? Wo verlaufen die Grenzen?“ Viele Gelehrte hätten sich seit dem 19. Jahrhundert an Fragen der Grenzen und an Merkmalsclustern abgearbeitet, erläutert die Historikerin. Zwischenzeitlich habe man sich aber davon wegbewegt, im Zuge des linguistic turn und des spatial turn: „Räume sind auch intellektuelle Konstrukte.“ Überall existierten mental maps, so Calic, die Forschung stelle heute ganz andere Fragen. So sei auch Südosteuropa „kein objektiv definierbarer Raum, sondern ein offenes Bild, je nach Interesse und Fragestellung fügen wir Länder dazu oder lassen sie weg.“ In den modernen Area Studies müsse man auch die Disziplinen versöhnen: „Wir gucken nach transregionalen, transnationalen Verbindungen, schauen, wie das Globale ins Regionale hineinwirkt.“ Heißt das, dass wir je nach Fragestellung eine ganz andere Region haben? Entscheidend, sagt Calic, sei das Erkenntnisinteresse, es stelle sich immer die Frage, „welche Kriterien lege ich zugrunde“.
Vergleichsmöglichkeiten und lokales Wissen
Für Professorin Dr. Valeska Bopp-Filimonov von der Friedrich-Schiller-Universität Jena sind Vergleich und die Komplexität der Vergleichsmöglichkeiten beim Thema Region von besonderer Relevanz. Faszinierend sei, wie beispielsweise Menschen und Sprache funktionierten, welch hohe Komplexität und Varianz oft in winzigen Räumen herrschten. Fragen, welche Faktoren dies begünstigen, welche nicht, ließen sich in unendlichen Schattierungen analysieren. Professor Dr. Ulf Brunnbauer, wissenschaftlicher Direktor des IOS und Inhaber des Lehrstuhls Geschichte Südost- und Osteuropas an der UR, erinnert in diesem Kontext an den Vorteil des Außenblicks auf eine Region: Entscheidend seien Balance, vertiefte Kenntnis, Distanz, letztlich auch pragmatische Zusammenhänge. Der Blick von außen ermögliche Vergleich, nationale Selbstbezüglichkeit gelte es zu überwinden.
Was ist lokales Wissen, will Andreas Ernst wissen? „Darüber bin ich gestolpert, der klingt ein wenig nach Vodoo.“ Sozialanthropologe Duijzings bringt den Begriff des vernacular knowledge ins Spiel, Historiker Brunnbauer betont das Phänomen lokal produzierten Wissens, das es einzubeziehen gelte, ebenso wie die Wissenschaftler:innen, die es generieren: „Das gehört auch zu unseren Aufgaben. Wir wollen Mittler sein, aber keinen Braindrain befördern.“ So interessiere man sich für „bestimmte Fragen oder Phänomene, die sich im Raum bewegen“. Dazu gehörten Themen wie die Verbundenheit von Menschen mit ihrer Herkunftsregion oder Migration. Das südöstliche Europa sei vielleicht stärker als andere Teile Europas durch diese geprägt, sagt Brunnbauer, so ließen sich transnationale Lebensräume und vielfältige historische Kontexte aufgreifen. Was Südosteuropa so spannend mache, sei seine Heterogenität, seine unterschiedlichen Funktionslogiken.
Die Region als „Laboratorium“?
Andreas Ernst greift im Verlauf der Diskussion die in der Projektvorstellung auftauchende Formulierung der Region als „Laboratorium der europäischen Integration“ auf, will genauer wissen, welche Art von Experimenten denn in Südosteuropa gemacht würden? Amüsement weicht den ernsten Beispielen, die IOS-Direktor Brunnbauer anführt. Er erinnert daran, dass Südosteuropa eine Region sei, die im Lauf der Zeit viele Interventionen erlebt habe; für internationale Organisationen in der jüngsten Vergangenheit sei sie tatsächlich „ein Expermentierfeld“ gewesen. Brunnbauer glaubt, dass die EU „viele neue Techniken der Integration oder eben Nicht-Integration entwickelt hat“. Sie habe auch neue Fragen gestellt, etwa, ob man „Stabilokratien“ dulde, ob man rechtsstaatliche Standards einfordern wolle. Zudem existierten unterschiedliche Stadien des EU-Beitritts. „Das ist die Region, in der sich das europäische Projekt entscheidet.“
Zum Ende des Gesprächs wirft Andreas Ernst eine Thematik auf, die Diskutant:innen und Publikum mit in den Abend nehmen: Was passiere denn auf dem Westbalkan, wenn nun die Ukraine und Moldau als Beitrittskandidaten anstehen? Die Meinungen zur Beitrittsreife der Westbalkan-Sechs, der Ukraine und der Republik Moldau sind geteilt – Marie-Janine Calic findet den Kandidatenstatus für Bosnien und Herzegowina verfrüht, auch gebe es „Akteure, mit deren Zynismus wir gar nicht rechnen“. Manuel Sarrazin glaubt, dass in der Ukraine vieles viel besser als in Bosnien und Herzegowina funktioniert. Ulf Brunnbauer sieht die EU in einer geopolitischen Zwangslage. Differenzierte Mitgliedschaften scheinen auch keine Option, auch nicht, einzelne Staaten „draußen zu lassen“. Einig ist man dahingehend, dass es rechtsstaatliche Standards braucht, die sich auch gerichtlich auf europäischer Ebene durchsetzen lassen. Die Teilnehmer:innen der Veranstaltung nehmen viele Anregungen mit in die informelle Diskussion, in die Andreas Ernst mit dem Schlusssatz eines Publikumsbeitrags zu Griechenland entlässt: „In Südosteuropa hat man oft nochmals eine andere Perspektive, als wir sie haben…“.
twa.
Informationen/Kontakt
seeFField - A small but fertile field: Strengthening Southeast European Studies in Regensburg. Zum Projekt seeFField und zum seeFField-Team
Zum DIMAS – Department für Interdisziplinäre und Multiskalare Area Studies der Universität Regensburg
Initiative Weltwissen – Strukturelle Stärkung "kleiner Fächer" der VolkswagenStiftung
Ansprechpartnerin:
Dr. Aleksandra Salamurović, Projektkoordinatorin
Telefon +49 941 943-5324
E-Mail: aleksandra.salamurovic@ur.de