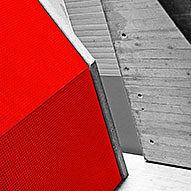„Das Buch ist tiefer als sein Titel“
Das literarische Quartett der UR meldet sich mit Romanen zwischen Abgründigem und Tiefgründigem zurück
Fotos von Michael Basche
25. Juli 2022
„Achtung Literatur!“ – unter diesem Titel findet seit 2018 ein literarisches Quartett mit Lehrenden und Studierenden der Universität Regensburg statt. Die fünfte Runde des Formats legt die Vermutung nahe, dass der Titel auch als Warnung zu verstehen ist, denn die am 21. Juli 2022 im Kaufmannsgewölbe im Haus der Begegnung präsentierten Romane sind nichts für empfindliche Gemüter: Thematisch geht es um Mobbing der übelsten Sorte, um Mord und Voyeurismus, um eine tragische Lebensbeichte und um eine ratlos machende Handlung voll von fiesem Personal. Trotz der harten Kost ist das literarische Stelldichein mit den Juristen Prof. Dr. Michael Heese und Prof. Dr. Tonio Walter, der neu hinzugewonnenen Philosophin Prof. Dr. Weyma Lübbe und dem (ehemaligen) Jurastudenten Lucas Nowottny unterhaltsam und tiefgründig.

Ratlosigkeit, aber nicht Unzufriedenheit
Professor Dr. Michael Heese stellt den Roman „Heaven“ der japanischen Autorin Mieko Kawakami vor: Der vierzehnjährige Ich-Erzähler fristet darin ein einsames Leben, gequält und gedemütigt durch seine Mitschüler. Er freundet sich mit einer gleichaltrigen Mitschülerin an, die ebenfalls Opfer der mobbenden Schülermeute ist. Im Verlauf der Handlung wird klar, dass die Opferrolle der beiden nichts mit ihrer vermeintlichen körperlichen Absonderlichkeit zu tun hat: Sie werden gemobbt, weil die Täter Lust dazu haben; dass die Wahl auf sie fällt, ist nichts als Zufall. „Für mich ist das die Kernaussage des Buchs“, so Michael Heese, „es ist die sinnlose Wahrheit hinter dem Mobbing“. Professor Dr. Tonio Walter ergänzt, das Buch habe ihn bedrückt, weil es die Ohnmacht schildert und erlebbar macht, die Willkür mit sich bringt. „Ich empfinde Ratlosigkeit, aber nicht Unzufriedenheit als Leser“ resümiert Tonio Walter.
Der Zuschauer in jedem von uns
Ebenfalls keine leichte Kost präsentiert Professorin Dr. Weyma Lübbe mit „Der Kameramörder“, einem Roman des österreichischen Schriftstellers Thomas Glavinic. In dem bereits 2001 erschienenen Werk schildert ein Ich-Erzähler in Form eines Protokolls wie er zusammen mit seiner Lebensgefährtin und einem befreundeten Ehepaar die Ostertage verbringt. Zentral dabei ist der vom Täter auf Video aufgenommene Mord an drei Kindern; die Aufnahmen landen bei einem Privatsender, der nicht nur das Filmmaterial zeigt, sondern auch die Ermittlung der Polizei im Fernsehen überträgt. Wie sich am Ende des Buches herausstellt, ist der Ich-Erzähler der Täter, das Protokoll endet mit dem Satz „Ich leugne nicht“. Weyma Lübbe sagt, sie habe ambivalent auf das Buch reagiert, es sei großartig konstruiert, sprachlich gelungen und schildere zugleich abstoßende Gewalt. Es kreise um das Thema Voyeurismus und die Frage, wie man als Bürger mit den Medien umgeht. Die Art und Weise wie der Täter die Kinder kurz vor ihrem Tod über ihre Gefühle befragt und an ihnen partizipieren will, verstehe sie als Analogie zu einer bestimmten Art von Berichterstattung. Lübbe wertet den Roman nicht als reine Medienkritik, es gehe „um den Zuschauer in jedem von uns“. Tonio Walter sieht den Sinn des Buches darin, die gefährliche Macht des Voyeurismus aufzuzeigen: „Wir wissen, dass wir uns für gewisse Dinge nicht interessieren sollten, machen es aber doch und fühlen uns dabei bestens unterhalten“.
 |  |  |
Das Buch ist tiefer als sein Titel
Lucas Nowottny ist an diesem Abend der Kritiker aus den Reihen der Studierenden. Da die fünfte Runde von „Achtung Literatur!“ durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie mehrmals verschoben werden musste, hat er mittlerweile sein Jura-Examen erfolgreich abgeschlossen. Nowottny hatte den Roman „Das Leben wartet nicht“ des italienischen Schriftstellers Marco Balzano ausgewählt. Geschildert wird darin die Lebensgeschichte von Ninetto, der in sehr jungen Jahren von Sizilien nach Mailand migriert, um dort Arbeit zu finden. Ninetto erinnert sich als Ich-Erzähler und alter Mann an seinen Lebensweg, an seine Arbeit, seine Heirat, seine Tochter und an eine schicksalsträchtige Fehleinschätzung, die ihn ins Gefängnis bringt und das Band zur Familie seiner Tochter zertrennt. Als er das Gefängnis nach zehn Jahren verlässt, beobachtet er Migranten aus China und Nordafrika, in denen er sein eigenes Schicksal gespiegelt sieht.
Der Erzählstrang allein lässt es nicht vermuten, doch gerade dieses Buch wird von den vier Kritiker:innen sehr unterschiedlich interpretiert. Lucas Nowottny versteht den Roman als Aufruf des Autors, einander zuzuhören. Michael Heese dagegen gibt unumwunden zu, er halte Protagonist Ninetto für einen Jammerlappen. Weyma Lübbe widerspricht, ihrer Meinung nach liege die Intention des Autors darin, der Art des Lebens von Ninetto – Arbeiterklasse, Hintergrund der Kindermigration – eine Stimme zu geben. Tonio Walter ist der Meinung, der Roman Bolzanos kreise in erster Linie um das Thema Männlichkeit, der Mann werde als Problem begriffen, das durch Frauen katalytisch zur Lösung gebracht wird. Er liest den Roman als Appell, nicht nur zu arbeiten und Geld zu verdienen, sondern das zu tun, wozu wir da sind: Lieben und das den Menschen, die wir lieben, auch zu sagen. Tonio Walter fasst zusammen: „Das Buch ist tiefer als sein Titel“.
Was ist Fiktion, was Realität und was soll das Ganze?
Beim letzten Buch des Abends, „Herr Oluf in Hunsum" von Christopher Ecker, sind sich die vier Rezensenten dann wieder einig: „Das Buch ist völlig banane“ (um es mit den Worten von Michael Heese zu sagen). Tonio Walter schickt voraus, er habe das Buch für den literarischen Abend ausgewählt, bevor er es gelesen hatte, und gesteht, etwas überfordert gewesen zu sein. Es geht um Philosophie-Professor Oluf Sattler, um seine Reise zu einem wissenschaftlichen Kongress und seine Irrfahrt zurück. Er lässt seine Frau und seinen Sohn krank zu Hause zurück, entwickelt daraufhin Schuldgefühle, die sich im Lauf der Handlung zu weiteren, älteren Schuldgefühlen gesellen. Der Kongress wird kein Erfolg für Sattler, zudem wird er auf dem Heimweg in einen Mord verwickelt. Den damit einsetzenden zweiten Teil der Handlung, Sattlers Rückkehr, habe sich ihm nicht erschlossen, so Tonio Walter. Ihm stelle sich die Frage: „Was ist Fiktion, was Realität und was soll das Ganze?“. Sprachlich sei der Roman immer wieder brillant, saukomisch und er habe sich hin und wieder ertappt gefühlt, was die Schilderung des Professoralen angehe. Michael Heese setzt entgegen, dass man ganz genau wisse, was im zweiten Teil des Buchs passiere, und fasst zusammen: „Sattler lässt sich scheiden, zieht in ein Studentenwohnheim, schreibt das Buch seines Lebens, erpresst jemanden das Buch zu protegieren und heiratet neu.“ Das Buch sei enorm unterhaltsam, so Heese, eben weil es so abgedreht und absurd ist. Weyma Lübbe ist vom Roman nicht überzeugt und gibt zu, sie verspüre im Moment nicht die Tendenz, von diesem Autor noch einmal etwas zu lesen. Im ganzen Buch habe sie keine einzige positiv gezeichnete Figur entdeckt, es träten durchwegs eitle, fiese, zickige und bauernschlaue Personen auf. „Aber ganz so schlimm, sind die Leute an Universitäten auch nicht, wie das hier geschildert wird“, so Weyma Lübbes versöhnliches Schlusswort.

Der Abend endet mit drei Leseempfehlungen: Michael Heese votiert für „Der Kameramörder“, sein Urteil lautet „hart aber gut“. Weyma Lübbe empfiehlt „Heaven“. Lucas Nowottny stimmt für „Das Leben wartet nicht“ und dieser Empfehlung schließt sich auch Tonio Walter an. Mit einem großen Dank an das Organisations-Team des Lehrstuhls und an den Sponsor des Abends, den Alumniverein Juratisbona, verabschiedet sich das literarische Quartett bis zum nächsten Mal.
Informationen/Kontakt
Informationen zur Veranstaltungsreihe "Achtung Literatur!" auf der Webseite des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Zivilverfahrens- und Insolvenzrecht, Europäisches Privat- und Prozessrecht sowie Rechtsvergleichung