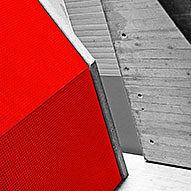Die Ukraine muss gewinnen
Expert*innen von Universität Regensburg und Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung (IOS) über ein Jahr Krieg im Osten Europas
24. Februar 2023
Der Wunsch, die Nachrichten des Vorabends seien nur ein böser Traum gewesen – um jeden Morgen herauszufinden, dass dem nicht so ist: So leitete Professor Dr. Ulf Brunnbauer, Akademischer Direktor des Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung (IOS), Sprecher der Graduiertenschule für Ost- und Südosteuropastudien und Inhaber des Lehrstuhls für Geschichte Südost- und Osteuropas an der Universität Regensburg (UR) in die Gesprächsrunde „Krieg gegen die Ukraine: Wie er Gesellschaft und Politik verändert“ am 22. Februar 2023 in Regensburg ein. Über 80 Interessierte, unter ihnen viele Ukrainer*innen, sprachen bei der Veranstaltung im Evangelischen Bildungswerk mit Expert*innen aus Geschichts-, Politik- und Literaturwissenschaften des Forschungsstandorts Regensburg – neben Moderator Brunnbauer Professorin Dr. Polina Barvinska, Professor Dr. Guido Hausmann, PD Dr. Gerlinde Groitl und Dr. Oleksandr Zabirko. Das Podium gab Einblick in die gegenwärtige Situation der Ukraine und in eine ungewisse Zukunft – nicht nur der Ukraine.

Krieg gegen die Ukraine: Gesprächsrunde mit Expert*innen von UR und IOS. Foto: Franz Kurz/IOS
Professorin Dr. Polina Barvinska von der Nationalen I.I. Mečnykov-Universität Odessa, die derzeit mit Unterstützung der Volkswagen Stiftung als Mitglied einer Arbeitsgruppe für geflüchtete ukrainische Wissenschaftler*innen am IOS tätig ist, skizzierte zu Beginn die komplexe Geschichte der deutsch-ukrainischen Beziehungen und erinnerte an die deutsche diplomatische wie finanzielle Unterstützung in den Jahren des Zerfalls des Sowjetimperiums: „Ich erinnere mich an die Krankenwägen in Odessa in den neunziger Jahren, die die Aufschrift Regensburg trugen.“ Gleichwohl stand die Ukraine in der deutschen Ostpolitik aber nicht an erster Stelle, sondern korrelierte meist mit den Wünschen Moskaus, erinnert Barvinska. Doch Deutschland trug maßgeblich zum Minsker Abkommen bei, es unterstützte Privatisierung, Föderalisierungsbemühen und zivilgesellschaftliches Engagement in der Ukraine. Noch nie aber seien die bilateralen Beziehungen so freundschaftlich gewesen wie im vergangenen Jahr.
Nicht verlieren reicht nicht
Doch es sind nicht nur Deutsche und Europäer, die sich solidarisch mit der Ukraine zeigen – auch und vor allem sind es die USA, deren Präsident Joe Biden ein Jahr nach dem landesweiten Angriff russischer Truppen auf die Ukraine ihre Hauptstadt besuchte. Um die globalpolitische Einordnung bat Brunnbauer PD Dr. Gerlinde Groitl, Politikwissenschaftlerin an der UR-Professur für internationale Politik und transatlantische Beziehungen. Europa sei sicherheitspolitisch nicht allein handlungsfähig, sagt die Forscherin, das Überleben der Ukraine abhängig von amerikanischer Unterstützung. Die USA seien nach wie vor zentraler Akteur, wenn es um militärische Ausrüstung oder auch deren Organisation gehe – man erinnere sich an die Diskussion um die Panzerlieferungen der vergangenen Monate. Ein Dilemma für die USA, die sich eigentlich gerne auf „outcompeting China“ konzentrieren würden und sich ausgewogene Lastenteilung mit der EU und den europäischen NATO-Staaten wünschten.
Die europäischen Staaten „sollten ihre Unterstützung hochfahren, weil das die größte Garantie für transatlantische Partnerschaft ist“, appelliert Groitl. Positiv aus ihrer Sicht das Bekenntnis des neuen deutschen Verteidigungsministers auf der letzten Münchner Sicherheitskonferenz: „Die Ukraine muss gewinnen“. Ein bemerkenswerter Satz, meint Groitl, denn bislang hieß es nur „die Ukraine darf nicht verlieren“. Doch sei dies nicht länger vermittelbar. Vorsicht ja, „aber die Ukraine hat nicht alle Zeit der Welt“. In jedem Konflikt gibt es den Faktor Zeitlichkeit – wer hält wie lange durch?
Vom Szenario des Sieges der Ukraine ausgehend will Ulf Brunnbauer von Groitl später wissen, ob sich die Welt nach einem ukrainischen Sieg auf einen neuen kalten Krieg einstellen müsse und ob China die Rolle des Vermittlers einnehmen könne? Eine Frage, die auch das Publikum bewegt. Groitls Antwort ist deutlich: Nein. China habe von Anbeginn des Krieges auf der russischen Seite gestanden, deren Position eingenommen, sagt Groitl. Die heutige Situation sei gefährlicher als der kalte Krieg: Die Welt ist global verflochten, „Russland und China sitzen gemeinsam an vielen Tischen, an denen sie die Macht des Faktischen wirken lassen können“, und beide Staaten teilen nicht Werte und Normen liberaler Demokratien. Die vielleicht bitterste der vielen bitteren Erkenntnisse des Abends folgt: „Wir müssen lernen, dass die Welt nicht von Harmonie geprägt ist, sondern dass Interessen von Staaten offenbar nicht überwunden werden können - egal, wie viele Formate man aufnimmt.“
Wo ist das andere Russland?
Manches, scheint es, hat man auch politisch versäumt. Ulf Brunnbauer erinnert daran, dass man der Südosteuropa-Forschung hinsichtlich der Kriege in Ex-Jugoslawien vorgeworfen habe, die Ereignisse nicht vorhergesehen zu haben. Im aktuellen Krieg habe man eher den Eindruck, dass die Zuhörbereitschaft der deutschen Politik, die Bereitschaft, wissenschaftliche Expertise abzurufen, nicht so groß gewesen sei, wie man es sich wünschen würde. Professor Dr. Guido Hausmann, am IOS Leiter des Arbeitsbereichs Geschichte und Inhaber der UR-Professur für osteuropäische Geschichte, zeichnet ein gemischtes Bild, was die Einbeziehung wissenschaftlicher Expertise zu den Ländern Osteuropas in politische Entscheidungsfindung der letzten Jahrzehnte angeht. Er erinnert, wie in den 1990er Jahren einschlägige ostwissenschaftliche Lehrstühle an den Universitäten abgeschafft wurden. Medien zogen Korrespondent*innen aus der Ukraine ab und ließen ihre Büros von Polen oder Moskau aus darüber berichten, was dort geschah. Häufig habe man sich von Seiten der Politik auf die Wirtschaft und damit Russland als primären Kooperationspartner konzentriert, neuerlichen Krieg als Option in Europa auch nicht denken wollen. Neuorientierung sei notwendig, betont Hausmann.
Auch bei Programmen zur Förderung des zivilgesellschaftlichen und wissenschaftlichen Dialogs lag der Fokus über viele Jahre hinweg schwerpunktmäßig auf Russland. Blicke man heute in russische Staatsmedien, sagt Brunnbauer, scheine man eine Art „Barbarisierungsphase“ zu erleben. „Läuft da etwas ganz grundsätzlich schief?“ Hausmann will den Begriff der Barbarisierung gerne vermeiden, gibt aber auch zu bedenken, dass der Krieg nicht nur Putins Krieg sei, sondern auch von Eliten und Teilen der Gesellschaft getragen werde. „Die Frage ist – Wo ist das andere Russland?“ Es habe immer wieder Demonstrationen gegeben, räsoniert Hausmann, Regime-Kritiker wie Alexej Navalnyj, Schriftsteller wie Boris Akunin oder Wladimir Sorokin haben sich öffentlich vom Putin-Regime und vom Krieg distanziert. Enttäuschend aber sei, dass Hundertausende Russ*innen, die ihr Land verlassen haben, sich nirgendwo kollektiv artikulierten. Man würde doch erwarten, meint Hausmann, dass sie sich auch einmal kollektiv, politisch organisiert mit einer solidarischen zukunftsgerichteten politischen Plattform zeigten.
Zwei Sprachen – oder eine?
Über die Rolle von Kulturschaffenden, Schriftstellern und Publizistinnen reflektiert Dr. Oleksandr Zabirko, Literatur- und Kulturwissenschaftler am Institut für Slavistik der UR. Grundsätzlich sei der Stellenwert der Schriftsteller in der Ukraine typisch für lange Zeit staatenlose Nationen, sagt Zabirko. „Wenn man kein Parlament und keine Presse hat, wird Gedankenaustausch in der Literatur möglich.“ Das habe sich lange geändert, doch ukrainische Schriftsteller*innen versuchten an diese Tradition anzuknüpfen. „Im Ausland sind sie die Erklärer und Aufklärer“, sagt Zabirko, sie erklärten Land, Kultur, Resilienz der Ukrainer*innen. Im ukrainischen Inland gehe es darum, Mut zu machen, selbstironisch, humorvoll, mit Literatur aber auch „Trauerarbeit angesichts der ganzen Zerstörung und des Blutzolls“ zu leisten.
Was passiere mit russischsprachiger Literatur in der Ukraine, wollen Moderator und Publikum erfahren. Die Frage, ob russophone Literatur in der Ukraine heute noch lebensfähig ist, sei keine, die man einfach so entscheiden könne, sie sei auch kein Verwaltungsakt, sagt Zabirko. Dynamiken ließen sich schwer prognostizieren. Doch die Zeichen sprächen für eine Homogenisierung der Kulturlandschaft. „Zum Glück fordert die Gesellschaft darauf auch noch keine abschließenden Antworten.“ Und die russische Sprache in der Ukraine? Die meisten Ukrainer*innen seien bilingual, sagt Zabirko. Letztlich sei es eine sehr persönliche Entscheidung, ob man es bleibe. Mit jeder weiteren Rakete sinke aber die Bereitschaft, viele sähen nur noch in der ukrainischen Sprache ihre Identität. Vergleichbare Einschätzungen hat Barvinska, die daran erinnert, dass es früher viele pro-russische Ukrainer*innen gab. Das habe sich grundlegend geändert, heute sei man sich weitgehend einig gegen Russland.
Und nach dem Krieg?
Um letztlich Mitglied der EU zu werden, was die Ukraine anstrebe, brauche es eine funktionierende Demokratie, reflektiert Brunnbauer. Krieg sei dafür wenig förderlich. Polina Barvinskas teilt diese Einschätzung. Die ukrainische Demokratie sei sehr jung, zur gleichen Zeit schockiere der Krieg die Menschen und verändere sie. Eine Vielzahl von Aktivisten, die Motor der ukrainischen Demokratie seien, würden aktuell an der Front getötet, regionale Medien gingen bankrott. „Wir wissen nicht, was nach dem Krieg passiert.“ Szenarien lassen sich viele denken. Vielleicht fehle dann die für demokratische Regierungssysteme wichtige Opposition, vielleicht komme es zu einer schlichten Machtaufteilung. Die Ukraine wird nach dem Krieg Wiederaufbau-Hilfe brauchen, sagt Barvinska, „diese muss sehr stark mit der Forderung an die politischen Eliten verbunden werden, demokratische Freiheiten zu garantieren und ohne Korruption zu arbeiten.“ Sie empfiehlt der Politik, die Wissenschaft bereits jetzt dazu zu hören.
Offene Fragen bleiben viele – trotz, vielleicht ob der kenntnisreichen Expertisen und Einblicke. Werden die Geflüchteten in die Ukraine zurückkehren? Zabirko berichtet aus persönlichen Gesprächen und erinnert daran, wie individuell die Schicksale sind: Reiche und Arme, Menschen mit verschiedenen Konfessionen, unterschiedlichen Alters, aus verschiedenen Regionen. „Manche Geflüchtete wollen nur noch nach Hause“, sagt Zabirko, erinnert an die Frauen mit Kindern, deren Männer an der Front kämpfen. Jüngere, die vor dem Schulabschluss stehen, wollen bleiben, vielleicht studieren, mit der Realisierung von Zukunftsplänen beginnen.
Sicher ist Zabirko aber, dass dauerhafter Frieden nur möglich ist, wenn das militärische Potenzial Russlands zerstört werde. Groitl geht in die gleiche Richtung, sieht aktuell kein realistisches Szenario, den Konflikt auf dem Verhandlungsweg zu regeln. Besonders schwierig sei der Umstand, dass „dieses Regime aufgehört hat, über ökonomische Realitäten nachzudenken“. Rechtlich seien die Dinge allerdings klar in der Charta der Vereinten Nationen geregelt – wer überfallen wird, darf sich verteidigen, auch gemeinsam mit anderen. „Jedem, dem etwas an der UN-Charta liegt, muss sich dafür einsetzen, dass Russland dieser Regelbruch nicht durchgeht.“

24. Februar 2023, Universität Regensburg.
twa.
Informationen/Kontakt
Die Veranstaltung der Graduiertenschule für Ost- und Südosteuropastudien (UR) wurde zusammen mit dem Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung, dem Leibniz-WissenschaftsCampus "Europa und Amerika" und dem Evangelischen Bildungswerk Regensburg e. V. organisiert.
Zu den Podiumsteilnehmer*innen Prof. Dr. Ulf Brunnbauer, Prof. Dr. Polina Barvinska, PD Dr. Gerlinde Groitl, Prof. Dr. Guido Hausmann, und Dr. Oleksandr Zabirko