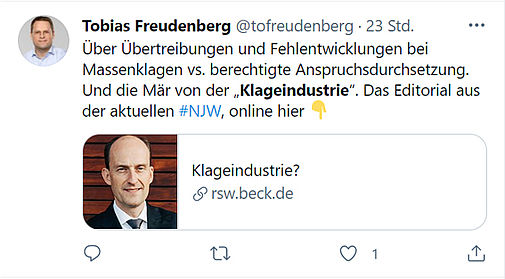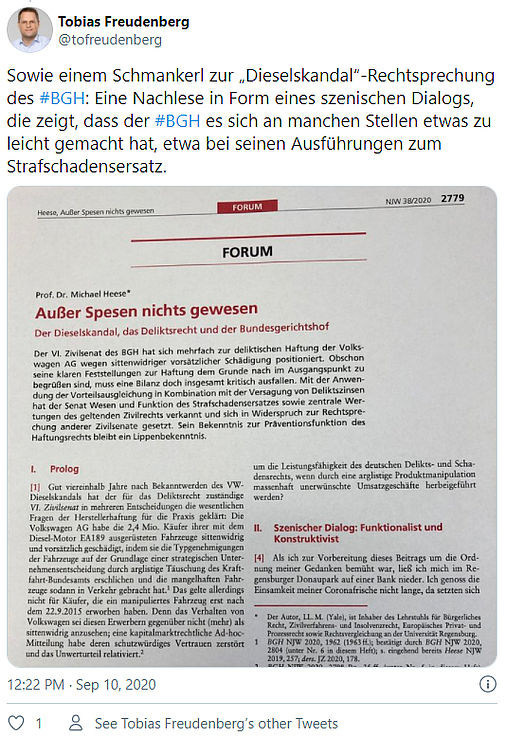Aktuelles
Univ.-Professor Dr. Michael Heese, LL.M. (Yale) - Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Zivilverfahrens- und Insolvenzrecht, Europäisches Privat- und Prozessrecht sowie Rechtsvergleichung


Hinweise zu Klausuren und Klausurrückgaben
Abschlussklausur zur Fortgeschrittenenübung Vertragliche und Gesetzliche Schuldverhältnisse WS 2025/2026
Schreibtermin: 9.2.2026 - 8.00 Uhr s.t.
Rückgabe mit Besprechung und Notenbekanntgabe: Mittwoch, 11.3.2026 - 10.00 Uhr c.t., H 18.
Wiederholerklausur zur Fortgeschrittenenübung Vertragliche und Gesetzliche Schuldverhältnisse WS 2025/2026
Schreibtermin: 9.4.2026 - 8.00 Uhr s.t.
Rückgabe mit Besprechung und Notenbekanntgabe: Mittwoch, 20.5.2026 - 10.00 Uhr c.t., Raum wird noch bekannt gegeben
Informationen zu Hilfsmitteln und Hörsaalbelegung finden Klausurteilnehmer in GRIPS. Beachten Sie unbedingt die Hinweise zur Remonstration.

Neuerscheinung: Michael Basche, Negative Beschaffenheitsvereinbarungen mit Verbrauchern
Michael Basche, Negative Beschaffenheitsvereinbarungen mit Verbrauchern. Wider eine Fürsorgeobliegenheit beim Verbrauchsgüterkauf, Diss. Regensburg, Verlag Mohr Siebeck, Studien zum Privatrecht (StudPriv), 2026, im Erscheinen.
Das Ziel der Europäischen Union, Ressourcen zu schonen und den Lebenszyklus von Produkten zu verlängern, wird geschwächt, wenn Unternehmen nicht bereit sind, mangelhafte Produkte - etwa aus Retouren - mit Preisnachlässen in den Wirtschaftskreislauf zurückzuführen. Der durch die offen gehaltene Formulierung der Tatbestandsmerkmale sowie unzureichende Vorgaben des Richtliniengebers entstandene Interpretationsspielraum bei § 476 Abs. 1 S. 2 BGB führt jedoch in der praktischen Umsetzung negativer Beschaffenheitsvereinbarungen zwischen Unternehmern und Verbrauchern zu Rechtsunsicherheit und hohen Transaktionskosten. Michael Basche arbeitet heraus, dass der europäische Gesetzgeber die Rechtslage ohne Not verändert hat - die verfolgten Regelungszwecke wurden bereits unter der bisherigen Rechtsordnung erreicht. Der Richtliniengeber schafft vielmehr ein Einfallstor für opportunistisches Verbraucherverhalten und verschiebt die materielle Vertragsgerechtigkeit.

Glosse. VW-Dieselskandal 2.0 oder: Und täglich grüßt das Murmeltier, JZ 2022, 776
In dem Hollywood-Klassiker „Und täglich grüßt das Murmeltier“ erlebt Wetteransager Phil Connors bekanntlich denselben Tag wieder und wieder. So oder so ähnlich müssen sich jetzt Volkswagen und viele Tausend Kunden des Konzerns fühlen.
Denn durch das "einfache und kostengünstige" Software-Update wurde lediglich eine "evident" unzulässige Abschalteinrichtung durch eine andere ("offensichtlich" den Zielen des europäischen Rechts zuwiderlaufende) unzulässige Abschalteinrichtung ersetzt - so hat es jedenfalls jetzt der EuGH mit drei inhaltsgleichen Urteilen v. 14. Juli 2022 in aller Klarheit festgestellt. Das ist Anlass genug für eine Glosse. Heese, VW-Dieselskandal 2.0 oder: Und täglich grüßt das Murmeltier, JZ 2022, 776.
Update zur nachfolgenden Instanzrechtsprechung der EU-Staaten
- VG Schleswig, Urt. v. 20.2.2023 - 3 A 113/18, BeckRS 2023, 2863: Klage der Deutschen Umwelthilfe gegen das KBA unmittelbar betreffend VW Software-Update für den EA 189 Motor wegen unzulässigem(!) Thermofenster erfolgreich; bestätigt von OVG Schleswig, Beschl. v. 25.9.2025 - 4 LB 36/23, BeckRS 2025, 24987.
- OGH Österreich, Teilurt. v. 27.2.2023 - 10 Ob 2/23a, BeckRS 2023, 2642: Gewährleistungsklage (Rückabwicklung) nach Kauf eines mit Prüfstandserkennung manipulierten EA 189-Fahrzeugs erfolgreich. Käufer muss sich das mit einem unzulässigen(!) Thermofenster versehene Software-Update nicht aufdrängen lassen.
- BGH, Urt. v. 1. 12.2022 – VII ZR 359/21, BeckRS 2022, 37681 und BGH, Beschl. v. 1.12.2022 – VII ZR 278/20, BeckRS 2022, 42610 (zu EuGH, Urt. v. 14.7.2022, C-128/20): Haftung der Volkswagen AG aus § 826 BGB / Grundfall EA 189 / Feststellungsklage und Feststellungsinteresse / Möglichkeit eines künftigen weiteren Schadenseintritts, da „behördliches Einschreiten wegen des Thermofensters im Software-Update mit der Folge eines weiteren Vermögensschadens des Klägers, etwa in Form von Stilllegungskosten, nicht auszuschließen“.

Neuerscheinung: Mareike Klappert, Respondeat superior und Unternehmensdeliktsrecht
Mareike Klappert, Respondeat superior und Unternehmensdeliktsrecht. Ein Plädoyer für eine Reform des § 831 BGB, Diss. Regensburg, Verlag Mohr Siebeck, Studien zum Privatrecht (StudPriv) 132, 2025. XVI und 201 Seiten.
Nach dem Willen des historischen Gesetzgebers sollten arbeitsteilig agierende Unternehmen im allgemeinen Deliktsrechtsverkehr für ihre Leute nur bei eigenem Verschulden einstehen müssen (§ 831 BGB). Die Rechtsprechung hat diese Privilegierung über mehr als ein Jahrhundert hinweg mittels einer ganzen Reihe dogmatischer Ausweichbewegungen ignoriert und kommt im Ergebnis häufig vergleichbar § 278 BGB zu einer strikten Haftung des Unternehmensträgers. Während die Kritik an der rechtspolitisch verfehlten Regelung des § 831 BGB auch im rechtswissenschaftlichen Diskurs fortdauert, hat sich weithin die Annahme durchgesetzt, dass die Rechtsprechung die als verfehlt erkannten Haftungslücken über die Jahre zumindest im Ergebnis angemessen geschlossen hätte. Mareike Klappert tritt dieser Annahme entgegen. Sie spricht sich offen gegen die methodisch misslungene Lückenschließung aus und fordert den Gesetzgeber auf, § 831 BGB zu streichen und durch die Einführung einer verschuldensunabhängigen Haftung nach dem Prinzip respondeat superior zu ersetzen.

Neuerscheinung: Anmerkung zum Urteil des BGH v. 28. Januar 2025 – VI ZR 109/23 (Zur Frage des immateriellen Schadens im Sinne des Art. 82 Abs. 1 DSGVO), JZ 2025, 472
Nach ständiger Rechtsprechung des BGH kann der Adressat einer unerwünschten Werbe-E-Mail als Ausfluss seines Rechts auf Privatsphäre einen Unterlassungsanspruch haben. Der VI. Zivilsenat des BGH hatte sich nun erstmals mit der datenschutzrechtlichen Dimension unerwünschter E-Mail-Werbung zu beschäftigen. Es ging konkret um die Frage, ob dem Adressaten auch ein Anspruch auf immateriellen Schadensersatz zustehen kann. In casu lehnte der BGH dies ab, weil der hierzu erforderliche tatsächliche Eintritt eines solchen Schadens nicht hinreichend dargelegt worden sei. Nach den in dieser Entscheidung formulierten Maßstäben dürfte das auch künftigen Klägern kaum gelingen - und dies mit recht, meint Michael Heese. Zum Fluch und Segen von Art. 82 Abs. 1 DSGVO: Heese JZ 2025, 472.

Neuerscheinung: Heese/Clemm, Referendarexamensklausur Zivilrecht: „Bitte nicht den Stecker ziehen!“, JuS 2024, 1151
Die anspruchsvolle Klausur behandelt Grundlagen der vertraglichen und deliktischen Haftung, insbes. die Abgrenzung von Körper- und Eigentumsverletzung bei abgetrennten Körperteilen, die Abgrenzung von Primär- und Folgeschäden, die Haftung bei sog. Schockschäden, die Schadenszurechnung bei sog. Begehrensneurosen und die Voraussetzungen der Hinterbliebenenentschädigung sowie materielle und prozessuale Grundfragen des Fortkommensschadens. Die Aufgabe ist teilweise als Richterfall und teilweise als Anwaltsfall gestaltet und verlangt insoweit neben einer über das unmittelbare Begehren hinausgehenden rechtlichen Würdigung auch Erwägungen zur Zweckmäßigkeit des prozessualen Vorgehens.

Neuerscheinung: Schumann/Heese Die ZPO-Klausur
Prof. Dr. Dr. h.c. Ekkehard Schumann
Prof. Dr. Michael Heese, LL.M. (Yale)
Die ZPO-Klausur, 4. Auflage 2024
Eine Anleitung zur Lösung von Fällen aus dem Erkenntnisverfahren und der Zwangsvollstreckung. Hinweise zur Bearbeitung der Hauptprobleme des Zivilprozeßrechts. 4. Auflage, München 2024, 275 Seiten, Verlag C.H.Beck.
Der Band stellt das Zivilprozessrecht fallbezogen dar. Er behandelt die Hauptprobleme des Erkenntnisverfahrens und des Zwangsvollstreckungsrechts aus der Sicht desjenigen, der einen Fall im Studium oder im Examen zu lösen hat. Von besonderer Bedeutung sind dabei die wichtigen Hinweise auf Schwierigkeiten und Fehler, die bei der Fallbearbeitung immer wieder auftreten.
Auszug aus der Rezension von Nowesky ZJS 2024, 624 ff.: "Bemerkenswert ist zunächst, dass – anders als allzu häufig der Fall – die Neuauflage nicht zu einer
Steigerung des Umfangs des Buches geführt hat. Mit der vierten Auflage ist das ohnehin schon bündige Werk nochmals um knapp 40 Seiten schlanker geworden. Zurückführen lässt sich dies auf eine der wohl größten Stärken des Buches und der Autoren: Die gelungene Schwerpunktsetzung. Weniger klausurrelevante Thematiken werden knapp erörtert, Klausurrelevantes und tatsächliche Problempunkte in der gebotenen Ausführlichkeit. An keiner Stelle verliert sich das Autorenduo in dogmatischen Verästelungen. [...] Die von Schumann/Heese vorgelegte vierte Auflage des Buches „Die ZPO-Klausur“ wird dem eigenen, bereits durch den Untertitel proklamierten Anspruch, eine Anleitung zur Lösung von Fällen aus dem Erkenntnisverfahren und der Zwangsvollstreckung zu sein, vollumfänglich gerecht. Das Werk schafft es, nicht nur das Wissen, sondern darüber hinaus auch die Kompetenz zur eigenständigen Klausurlösung zu vermitteln."

Interview: Wie Start-ups die Gerichte fordern
Professor Heese spricht im Interview mit Anna Sophie Kühne (FAZ) darüber, warum zu wenige Verbraucher ihre Rechte durchsetzen und warum von dem von der Unternehmenslobby für Legal-Tech-Kanzleien propagierten Begriff der "Klageindustrie" nichts zu halten ist: Wie Start-ups die Gerichte fordern - Mithilfe von Onlineportalen können Millionen Verbraucher ihre Ansprüche gegen Konzerne durchsetzen. Die deutsche Justiz ist auf die Klagewelle kaum vorbereitet, FAZ-Sonntagszeitung v. 27.10.2024.
Zum Begriff der "Klageindustrie", mit dem lt. Professor Heese Ursache und Wirkung verwechselt werden und zu seinen von der Bundespolitik fortgesetzt übergangenen Forderungen für mehr effektiven kollektiven Rechtsschutz s. schon Heese, NJW-Editorial 9/2021 und Heese, NJW-Editorial 27/2023.

Ankündigung: Jaeger InsO, Großkommentar zur Insolvenzordnung, 2. Auflage, Band 1
Jaeger, Insolvenzordnung, Großkommentar, Band 1, §§ 1-35 InsO, 2. Auflage. Vollständige Neukommentierung der §§ 20-25 InsO [Auskunfts- und Mitwirkungspflichten des Schuldners sowie vorläufige Maßnahmen des Insolvenzgerichts im Eröffnungsverfahren] auf ca. 380 Seiten. Erscheint vsl. im Frühjahr 2026.

EDMC 2024: Team Regensburg gewinnt erneut am BGH
Felix Summerer (Lehrstuhl Prof. Heese) und Bastian Reinsch haben als Regensburger Team den ELSA Deutschland Moot Court (EDMC) 2024 gewonnen!
Nach ihrem ersten Erfolg beim Regensburger Lokalentscheid im Januar 2024 setzte sich das Regensburger Team zunächst beim Nationalentscheid in Berlin gegen zwölf andere Teams durch und erhielt besondere Anerkennung für seine herausragende Klageschrift. Im Bundesentscheid, dem Finale des Wettbewerbs, trafen sie am 28. Juni 2024 beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe auf das Team der Universität Osnabrück, wo sich die Regensburger wiederum durchsetzen konnten.
Im Erfolg des Teams Regensburg bestätigt sich erneut die gute Vorbereitung durch erfahrene Coaches und die fundierte Ausbildung im Zivilprozessrecht, das neben dem Familienrecht traditionell zu den tragenden Säulen des Regensburger Zivilrechts zählt. Im Jahr 2021 hatten bereits Anna Gmehling (Lehrstuhl Prof. Heese) und Elina Mayer (Lehrstuhl Prof. Kühling) als Regensburger Team den ELSA Deutschland Moot Court gewonnen. 2024 heißt es wieder: Herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen Leistung!

Neuerscheinung: Isabella Clemm, Vorläufige Maßnahmen im Sanierungs- und Insolvenzrecht
Isabella Clemm, Vorläufige Maßnahmen im Sanierungs- und Insolvenzrecht - Kriterien für die gerichtliche Anordnungsentscheidung, Diss. Regensburg, Verlag Mohr Siebeck, Veröffentlichungen zum Verfahrensrecht Bd. 201, 2024. XXI und 243 Seiten.
Insolvenzgerichte ordnen tagtäglich vorläufige Maßnahmen an, in aller Regel aber ohne sie näher zu begründen. Zudem liegen weder die Anordnungsvoraussetzungen noch die entscheidungsleitenden Kriterien ohne Weiteres auf der Hand und für Rechtsanwender wie Rechtssuchende bestehen erhebliche Unsicherheiten. Das liegt bereits darin begründet, dass die Verfahrenslage nicht homogen ist, sondern aufgrund der multipolaren Interessenlage stark variieren kann. Isabella Clemm entwirft einen umfassenden dogmatischen Unterbau für die gerichtliche Entscheidung über vorläufige Maßnahmen und systematisiert das relevante zeitliche Stadium zwischen Krise und Insolvenz ausgehend von Verfahrenstypen. Daraus entsteht ein praktisch handhabbares Modell für die gerichtliche Anordnung vorläufiger Maßnahmen im Insolvenzeröffnungsverfahren.

Rückblick: Achtung - Literatur! am 16. November 2023
Achtung - Literatur! Studierende und Lehrende der Universität Regensburg stellen Bücher vor und sprechen über sie: über ihre Geschichten, Hintergründe und ihre Sprache.
Die Bücher gehören überwiegend zu den aktuellen Programmen der Verlage, können aber auch wiedergelesene und wiederentdeckte ältere Werke sein. Belletristisches steht im Vordergrund, wichtige Sachbücher können auch dabei sein. An jedem Diskussionsabend geht es um vier Bücher, die vorab bekannt gegeben und in der Gesprächsrunde vorgestellt werden. Mitlesende, Mitdiskutierende und Zuhörer sind herzlich willkommen!
Die sechste Runde von Achtung - Literatur! fand am Donnerstag, den 16. November 2023 in der Universitätsbibliothek statt. Aus dem Kreis der Studierenden war Lilli Bauer (Germanistik) dabei. Wir haben uns über das zahlreiche und interessierte Publikum wieder sehr gefreut! Vorgestellt und besprochen wurden:
1. "Adas Raum" von Sharon Dodua Otoo
(vorgestellt von Lilli Bauer)
2. "Nastja" von Vladimir Sorokin
(vorgestellt von Michael Heese)
3. "Der Anfang von Morgen" von Jens Liljestrand
(vorgestellt von Weyma Lübbe)
4. "Der Rote Diamant" von Thomas Hürlimann
(vorgestellt von Tonio Walter)
Eindrücke vom Veranstaltungsabend und weitere Informationen zum Veranstaltungsformat finden Sie unter go.uni-regensburg.de/achtungliteratur

Neuerscheinung: NJW Editorial 41/2023 – K(r)ampf mit der Anonymisierung
Gerichtsentscheidungen – auch der Instanzgerichte – sind ausnahmslos zu veröffentlichen (vgl. Heese, FS Roth, 2021, S. 283, 293 ff, 337 f.). Die Politik hat das erkannt. Gerichtsentscheidungen“, so der Koalitionsvertrag, „sollen grundsätzlich in einer Datenbank öffentlich und maschinenlesbar verfügbar sein“. Allerdings soll die Veröffentlichung „in anonymisierter Form“ geschehen. Das ist in dieser Pauschalität nicht richtig und stellt die Justiz vor eine praktische Herausforderung. Über den K(r)ampf mit der Anonymisierung berichtet Professor Heese im NJW Editorial 41/2023.

Neuerscheinung: NJW Editorial 27/2023 – Zu kurz gesprungen
Das Bundesjustizministerium plant die Einführung eines Leitentscheidungsverfahrens (LeitEVerf) beim BGH. Der Referentenentwurf muss als Gegenentwurf zum Vorschlag eines Vorabentscheidungsverfahrens beim BGH (Heese/Schumann NJW 2021, 3023) verstanden werden. Das BMJ ist damit zwar gesprungen, aber viel zu kurz. Ein bloßes LeitEVerf reicht nicht aus; es ist vielleicht ein Kiesel, aber sicher kein „Baustein für eine effiziente Erledigung von Massenverfahren“, meint Professor Heese im NJW-Editorial 27/2023.
Vgl hierzu nun auch die Kritik des Deutschen Richterbundes: "[D]as hier vorgeschlagene Leitentscheidungsverfahren [greift] erheblich zu kurz. Es lässt keine spürbare Entlastung der Zivilgerichte erwarten".
Inzwischen liegen zahlreiche Stellungnahmen von Interessengruppen vor, die das Leitentscheidungsverfahren ebenfalls ganz überwiegend ablehnen und mehrheitlich die Einführung eines Vorabentscheidungsverfahrens fordern. Das wesentlich weitergehende Vorabentscheidungsverfahren wird uA auch befürwortet von
- Whitepaper des Deutschen Richterbunds zu Massenverfahren v. 13.5.2022, S. 14 ff: "Die AG Massenverfahren spricht sich für die Einführung eines
Vorabentscheidungsverfahrens in Massenverfahren beim zuständigen
Revisionsgericht aus." -
93. Justizministerkonferenz v. 1./2.6.2022, TOP I.6: "Der Anspruch auf effektiven Rechtsschutz erfordert eine rasche rechtssichere Klärung der den Massenverfahren zugrunde liegenden Rechtsfragen. Hierzu kann auch auf die Vorschläge der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zum Vorabentscheidungsverfahren zurückgegriffen werden."
-
Antrag der Fraktion der CDU/CSU v. 7.2.2023: "Kollaps der Ziviljustiz verhindern – Wirksame Regelungen zur Bewältigung von Massenverfahren schaffen", BT-Drucks. 20/5560: "Um die Funktionsfähigkeit der Ziviljustiz zu erhalten, besteht dringender gesetzgeberischer Handlungsbedarf. [...] Dies umfasst die Einführung eines Vorabentscheidungsverfahrens, durch das die in Massenverfahren auftretenden entscheidungserheblichen Rechtsfragen frühzeitig einer höchstrichterlichen Klärung zugeführt werden können."

Neuerscheinung: Regulierung durch Kaufrecht – Schwerpunkte und Defizite der EU-Warenkaufrichtlinie, AcP 222 (2022), 703
Regulierung, also die mit Steuerungsintention erfolgte Umsetzung politischer Allgemeinwohlziele, ist ein Anliegen der Gesamtrechtsordnung – und damit auch des Zivilrechts. Die europäische Privatrechtsharmonisierung steht regulatorisch im Dienst der Verwirklichung des Binnenmarkts. Der konkrete Regulierungsbeitrag des europäischen Kaufrechts wurde mit der WarenkaufRL nochmals deutlich verstärkt. Der Beitrag betrachtet das reformierte EU-Kaufrecht aus der Regulierungsperspektive anhand zentraler Regulierungsziele, die zum Zweck der Verwirklichung des Binnenmarkts Eingang in die Kaufrechtsharmonisierung gefunden haben, die Förderung eines regenerativen Wachstums durch nachhaltige Konsumgüter und den Verbraucherschutz. Überdies wird ein blinder Fleck der europäischen Privatrechtsregulierung identifiziert, die Prävention arglistigen Verhaltens. Der Beitrag kommt zu dem Ergebnis: Die WarenkaufRL ist teilweise als vielversprechend, teilweise als überschießend und teilweise als defizitär zu bewerten. Heese, AcP 222 (2022), 703-735. Zum Inhaltsverzeichnis.

NJW Editorial 26/2022 – Rom liegt nicht in Karlsruhe
Mit seinem VW-Grundsatzurteil (NJW 2020, 1962) wollte der VI. Zivilsenat des BGH die Grundlagen der deliktischen Herstellerhaftung geklärt wissen; von einem Machtwort aus Karlsruhe war die Rede: „Roma locuta, causa finita” (Lorenz NJW 2020, 1924). Doch zeigt sich einmal wieder: Rom liegt nicht in Karlsruhe. Professor Heese im NJW-Editorial Heft 26/2022 zum Votum des Generalanwalts am EuGH Athanasios Rantos v. 2.6.2022 (vgl. BeckRS 2022, 12232) und seinen Folgen für abgeschlossene, laufende und neue Verfahren.
EuGH folgt GA: Mit Urt. v. 21.3.2023 hat sich der EuGH erwartungsgemäß dem GA angeschlossen, vgl. die Pressemitteilung des EuGH zu EuGH, Urt. v. 21.3.2023, Rs. C-100/21 (Mercedes-Benz AG): Unionsrecht schützt auch die Einzelinteressen des individuellen Käufers eines Kraftfahrzeugs / Mitgliedstaaten müssen Schadensersatz des Käufers gegen den Hersteller vorsehen / Schadensersatz nach nationalem Recht muss auch bei Anrechnung der Nutzungen in angemessenem Verhältnis zum Schaden stehen.

Wer sich festklebt, haftet! LTO-Gastkommentar v. 20.12.2022
Müssen Klimaaktivisten, die Flughäfen blockieren, finanziell für Schäden aufkommen? Nachdem ein LTO-Gastbeitrag das mit einem klaren "Nein" beantwortete, meint Michael Heese nun: Doch, sie handeln sittenwidrig. LTO Gastkommentar v. 20.12.2022.

Ein Vorabentscheidungsverfahren beim BGH, Heese/Schumann NJW 2021, 3023
Nach dem Willen der Justizministerkonferenz könnte es in Zivilsachen zur Einführung eines Vorabentscheidungsverfahrens beim BGH kommen. Das Prozessinstitut soll eine „zügige höchstrichterliche Klärung grundsätzlicher Rechtsfragen in Bezug auf Massenverfahren“ erreichen. Es dient der Prozessökonomie sowie wirksamer Justizgewährleistung und bewegt sich auf der Schnittstelle von individuellem und kollektivem Rechtsschutz.
Der Beitrag begrüßt das Reformvorhaben, erläutert, was man von einem solchen Verfahren erwarten kann und was nicht und skizziert wesentliche Fragen, die sich bei der Umsetzung stellen. Heese/Schumann, NJW 2021, 3023-3029.
Im Nachgang interessant
- Koalitionsvertrag 2021-2025 zwischen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP, S. 106: "Wir bauen den kollektiven Rechtsschutz aus. Bestehende Instrumente wie z. B. nach dem Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz modernisieren wir und prüfen den Bedarf für weitere. Die EU-Verbandsklagerichtlinie setzen wir anwenderfreundlich und in Fortentwicklung der Musterfeststellungsklage um und eröffnen auch kleinen Unternehmen diese Klagemöglichkeiten."
- Whitepaper des Deutschen Richterbunds zu Massenverfahren v. 13.5.2022, S. 14 ff: "Die AG Massenverfahren spricht sich für die Einführung eines
Vorabentscheidungsverfahrens in Massenverfahren beim zuständigen
Revisionsgericht aus." -
93. Justizministerkonferenz v. 1./2.6.2022, TOP I.6: "Der Anspruch auf effektiven Rechtsschutz erfordert eine rasche rechtssichere Klärung der den Massenverfahren zugrunde liegenden Rechtsfragen. Hierzu kann auch auf die Vorschläge der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zum Vorabentscheidungsverfahren zurückgegriffen werden."
-
Antrag der Fraktion der CDU/CSU v. 7.2.2023: "Kollaps der Ziviljustiz verhindern – Wirksame Regelungen zur Bewältigung von Massenverfahren schaffen", BT-Drucks. 20/5560: "Um die Funktionsfähigkeit der Ziviljustiz zu erhalten, besteht dringender gesetzgeberischer Handlungsbedarf. [...] Dies umfasst die Einführung eines Vorabentscheidungsverfahrens, durch das die in Massenverfahren auftretenden entscheidungserheblichen Rechtsfragen frühzeitig einer höchstrichterlichen Klärung zugeführt werden können."

Sachaufklärung im Dieselskandal - Probleme und Abhilfen, NJW 2021, 887-893
Der Dieselskandal hat zwei Individualklagewellen nach sich gezogen, die die Zivilgerichtsbarkeit bundesweit seit Jahren extrem belasten. Die erste Klagewelle bewirkte inzwischen die höchstrichterliche Klärung zentraler Fragen. Die zweite Klagewelle verursacht an den Instanzgerichten einen noch weitaus höheren Aufwand, weil die ihr zugrunde liegenden Sachverhalte bis heute nicht (hinreichend) aufgeklärt sind. Die Möglichkeiten ebenso wie die Grenzen gerichtlicher Sachaufklärung im Zweiparteienprozess stehen im Mittelpunkt des Beitrags; ergänzt wird die Analyse durch Überlegungen zu einem verbesserten System des kollektiven Rechtsschutzes. Heese NJW 2021, 887-893.
Im Nachgang interessant:
- 93. Justizministerkonferenz v. 1./2.6.2022, TOP I.6: "Es bedarf Regelungen, die unter Wahrung der Parteirechte eine Konzentration von Beweisaufnahmen ermöglichen, um bei gleichgelagerten Sachverhalten die vielfache Wiederholung von Zeugenvernehmungen und Sachverständigengutachten zu vermeiden." Dazu, dass das richtig ist und wie das konkret aussehen könnte: Heese NJW 2021, 887, 892 f.
- Horn/Rieder, Mehr kollektiven Rechtsschutz wagen?, ZPO-Blog v. 3.6.2022: "Darüber hinaus kommt eine Bündelung paralleler Einzelverfahren über Gerichtsbezirksgrenzen hinweg vergleichbar mit der Multidistrict Litigation in den USA in Betracht (vgl. Heese, NJW 2021, 887, Rn. 33 ff.). Eine solche Bündelung hätte den Vorteil, dass auch die Ergebnisse einer Beweisaufnahme für eine Vielzahl an Klägern verwertet werden könnten."
- Antrag der Fraktion der CDU/CSU v. 7.2.2023: "Kollaps der Ziviljustiz verhindern – Wirksame Regelungen zur Bewältigung von Massenverfahren schaffen", BT-Drucks. 20/5560: "Um die Funktionsfähigkeit der Ziviljustiz zu erhalten, besteht dringender gesetzgeberischer Handlungsbedarf. [...] Ferner sind Regelungen zu schaffen, [...] die eine [...] Übertragung in einzelnen Massenverfahren durchgeführter Beweisaufnahmen auf andere Verfahren des gesamten Massenkomplexes zulassen.

Veröffentlichung gerichtlicher Entscheidungen im Zeitalter der Digitalisierung, in: Althammer/Schärtl, Festschrift für Herbert Roth zum 70. Geburtstag, 2021, S. 283-340
Die Veröffentlichung gerichtlicher Entscheidungen ist ein zentraler und gleichwohl wenig beachteter Bestandteil der Gerichtsöffentlichkeit. Mit den Überlegungen zu Ehren von Herbert Roth soll ein strukturelles Defizit offengelegt und eine überfällige Debatte angestoßen werden.
Heese, Veröffentlichung gerichtlicher Entscheidungen im Zeitalter der Digitalisierung – Entwicklungsstand und Entwicklungsdefizite einer Funktionsbedingung des modernen Rechtsstaats, in: Althammer/Schärtl, Dogmatik als Fundament für Forschung und Lehre, Festschrift für Herbert Roth zum 70. Geburtstag, 2021, S. 283-340. Auszug aus der Abhandlung: Einleitung - Kernthesen - Regelungsvorschlag.
Im Nachgang interessant Koalitionsvertrag 2021-2025 zwischen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP, S. 106: "Gerichtsentscheidungen sollen grundsätzlich in
anonymisierter Form in einer Datenbank öffentlich und maschinenlesbar verfügbar sein".

NJW Editorial 3/2022 – Mass Cases Make Bad Law
Hard Cases & Great Cases Make Bad Law. Doch auch die schiere Masse gleichgelagerter Fälle hinterlässt Schneisen in der gewohnten Qualität richterlicher Rechtsfindung. Das zeigt sich (abermals) bei der Aufarbeitung des Dieselskandals - findet Michael Heese und fordert eine beherzte Reform der zivilprozessualen Sachaufklärung im NJW-Editorial Heft 3/2022.
Im Nachgang interessant: BGH, Beschl. v. 10.1.2023 – VIII ZR 9/21, BeckRS 2023, 1723: Mercedes-Benz mit Motor OM 642 und unzulässiger Kühlmittel-Solltemperatur-Regelung (KSR) als Sachmangel. Zur auch deliktsrechtlichen Relevanz des Beschluses siehe Rn. 29: „Sollte die Kühlmittel-Solltemperatur-Regelung daher - wie von der Klägerin behauptet - nahezu ausschließlich im Prüfstand die Abgasreinigung verstärkt aktivieren, wäre dieser Umstand grundsätzlich geeignet, um auf eine arglistige Täuschung der Genehmigungsbehörden und ein entsprechendes Unrechtsbewusstsein der Beklagten schließen zu lassen“.

Vorlesung ZPO II als Videopodcast
Liebe Studierende,
während des universitären Corona-Lockdowns im Wintersemester 2020/2021 habe ich die Vorlesung "ZPO II - Zwangsvollstreckungsrecht" live per Zoom übertragen und gleichzeitig als Videopodcast aufgezeichnet. Die Podcastreihe besteht aus 16 Folgen und der Vorlesungsstoff umfasst eine geschlossene Darstellung des Zwangsvollstreckungsverfahrens einschließlich der vollstreckungsrechtlichen Rechtsbehelfe sowie des einstweiligen Rechtsschutzes.
Zunächst war der Podcast nur für Regensburger Studierende abrufbar. Im Wintersemester 2022/2023 habe ich mich dazu entschlossen, den Podcast öffentlich zugänglich zu machen. Dies, weil mich entsprechende Anfragen erreicht haben und weil ich aus vielen Gesprächen mit Studierenden und Referendaren weiß, dass das Interesse für das Zwangsvollstreckungsrecht häufig erst später im Laufe des Studiums bzw. des Referendariats geweckt wird. Dann hat man aber zumeist nicht mehr die Zeit (oder die Gelegenheit) eine entsprechende Vorlesung zu besuchen. Der Videopodcast kann hier vielleicht eine Lücke füllen.
Die Powerpointfolien des Videopodcasts habe ich aktualisiert und auf den aktuellen Gesetzgebungsstand (Gesetz zur Verbesserung des Schutzes von Gerichtsvollziehern vor Gewalt sowie zur Änderung weiterer zwangsvollstreckungsrechtlicher Vorschriften vom 7. Mai 2021) gebracht.
Sollten Sie beim Anschauen und Anhören den einen oder anderen Fehler finden, haben Sie zwei Möglichkeiten: Sie können ihn entweder behalten oder - noch besser - dem Lehrstuhlteam eine kurze E-Mail schreiben, damit ich das bei meiner aktuellen Präsenzvorlesung berücksichtigen kann.
Sie können die Vorlesung abrufen in der Mediathek der Universität Regensburg und - in etwas besserer Qualität - auch über den YouTube-Kanal des Lehrstuhls.
Ich wünsche Ihnen viel Spass mit dem Zwangsvollstreckungsrecht!
Prof. Dr. Michael Heese

NJW Editorial 36/2021 – Verbrauchergerecht?
Mit „Legal-Tech-Inkasso“ und „Consumer Claim Purchasing“ wollen private Unternehmen eine staatlich hinterlassene Rechtsschutzlücke schließen. Rechtsprechung (VIII ZR 285/18 / II ZR 84/20) und Gesetzgebung tun gut daran, diese Entwicklung zu fördern. Doch darf die Deregulierung nicht zur Folge haben, dass sich das private Versprechen wirkungsvollen Rechtsschutzes ins Gegenteil verkehrt.
Dass diese Gefahr besteht, zeigt das Beispiel des aktuell stattfindenden Ankaufs von Erstattungsansprüchen gegen Betreiber von Fitnessstudios. Heese, NJW-Editorial Heft 36/2021: Verbrauchergerecht?
Zur der von Professor Heese in diesem Beitrag festgestellten "Eindeutigkeit" der Rechtslage in Bezug auf Beitragspflicht und Vertragsverlängerung bei coronabedingter Fitnessstudioschließung s. jetzt auch BGH, Urt. v. 4. Mai 2022 – XII ZR 64/21: "Der Betreiber eines Fitnessstudios hat [...] gegen seinen Vertragspartner keinen Anspruch auf eine Vertragsanpassung wegen Störung der Geschäftsgrundlage dahingehend, dass die vereinbarte Vertragslaufzeit um den Zeitraum einer pandemie-bedingten Schließung des Fitnessstudios verlängert wird." Und im Nachgang interessant: Musterfeststellungsklage gegen die East Bank Club The Fitness Factory GmbH ("SuperFit Sportstudios") endet nach richterlichem Hinweis auf BGH-Urteil mit Anerkenntnisurteil, vgl. KG Berlin, Anerkenntnisurt. v. 29.8.2022 - 20 MK 1/21, BeckRS 2022, 24605.

Glückwunsch - Ekkehard Schumann zum 90. Geburtstag, JZ 2022, 27
Am 28. Dezember 2021 hat Ekkehard Schumann seinen 90. Geburtstag gefeiert. Aus diesem Anlass ehrt ihn der Verlag Mohr Siebeck mit einem von Michael Heese und Tonio Walter verfassten Glückwunsch. Heese/Walter JZ 2022, 27.

NJW Editorial 9/2021 – Klageindustrie?
Der Dieselskandal hat Individualklagewellen nach sich gezogen, die die Zivilgerichte bundesweit seit Jahren überlasten. Die hieraus entstandene Diskussion um eine sich angeblich entwickelnde "Klageindustrie" ist unausgewogen und nicht zielführend. Wer eine "Klageindustrie" am Werk sieht, verwechselt Ursache und Wirkung findet Professor Heese und fordert im NJW-Editorial Heft 9/2021 mehr kollektiven Rechtsschutz.

Die praktisch uneingeschränkte Pflicht des Staates zur Veröffentlichung der Entscheidungen seiner (obersten) Gerichte, JZ 2021, 665
Der Staat ist von Verfassungs wegen zur lückenlosen und ungekürzten Veröffentlichung der Entscheidungen seiner Gerichte verpflichtet. Eine Entscheidung muss hierzu nicht besonders „veröffentlichungswürdig“ sein. Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung soll nach überwiegender Auffassung zwar die Anonymisierung persönlicher Angaben und Umstände erforderlich machen. Weitergehende Schwärzungen von Sachverhalt oder Entscheidungsgründen lassen sich mit den Persönlichkeitsrechten der Beteiligten dagegen typischerweise nicht begründen. An einem unlängst gescheiterten Versuch, die Veröffentlichung zweier BGH-Entscheidungen unter Berufung auf den Ehrschutz in größtmöglichem Umfang zu verhindern, lassen sich diese Grundsätze und einige verfahrensrechtliche Besonderheiten veranschaulichen. Und im Hinblick auf die noch immer bruchstückhafte Veröffentlichung der Entscheidungen der Instanzgerichtsbarkeit ist festzustellen: Entscheidungsöffentlichkeit ist ein Reformthema für das digitale Zeitalter. Heese, Die praktisch uneingeschränkte Pflicht des Staates zur Veröffentlichung der Entscheidungen seiner (obersten) Gerichte – Zu OLG Karlsruhe v. 22.12.2020 – 6 VA 24/20, JZ 2021, 665.
Vgl. weiterführend Heese, Veröffentlichung gerichtlicher Entscheidungen im Zeitalter der Digitalisierung – Entwicklungsstand und Entwicklungsdefizite einer Funktionsbedingung des modernen Rechtsstaats, in: Althammer/Schärtl, Dogmatik als Fundament für Forschung und Lehre, Festschrift für Herbert Roth zum 70. Geburtstag, 2021, S. 283-340. Auszug aus der Abhandlung: Einleitung - Kernthesen - Regelungsvorschlag. Zum Thema auch eingehend Hamann, Der blinde Fleck der deutschen Rechtswissenschaft – Zur digitalen Verfügbarkeit instanzgerichtlicher Rechtsprechung, JZ 2021, 656 und Hamann, Transparenz der Justiz, Stagnation seit 50 Jahren, LTO v. 2.7.2021.

Außer Spesen nichts gewesen - Der Dieselskandal, das Deliktsrecht und der Bundesgerichtshof, NJW 2020, 2779
Der VI. Zivilsenat des BGH hat sich mehrfach zur deliktischen Haftung der Volkswagen AG wegen sittenwidriger vorsätzlicher Schädigung positioniert. Obschon seine klaren Feststellungen zur Haftung dem Grunde nach im Ausgangspunkt zu begrüßen sind, muss eine Bilanz doch insgesamt kritisch ausfallen. Mit der Anwendung der Vorteilsausgleichung in Kombination mit der Versagung von Deliktszinsen hat der Senat Wesen und Funktion des Strafschadensersatzes sowie zentrale Wertungen des geltenden Zivilrechts verkannt und sich in Widerspruch zur Rechtsprechung anderer Zivilsenate gesetzt. Sein Bekenntnis zur Präventionsfunktion des Haftungsrechts bleibt ein Lippenbekenntnis. Heese NJW 2020, 2779.

Wiederaufnahme: Herstellerhaftung für manipulierte Diesel-Kraftfahrzeuge – Ein Streifzug durch die Rechtsprechung der Oberlandesgerichte, JZ 2020, 178.
Der Bundesgerichtshof wird sich voraussichtlich im Mai 2020 erstmals mit einer gegen die Volkswagen AG erhobenen Klage öffentlich befassen. Der Beitrag knüpft an die Ausführungen des Verfassers in NJW 2019, 257 zur „Herstellerhaftung für manipulierte Diesel-Kraftfahrzeuge“ an und behandelt schwerpunktmäßig die seither ergangene und inzwischen umfangreiche Rechtsprechung der Oberlandesgerichte. Nach ganz überwiegender Auffassung haftet die Volkswagen AG den Käufern dem Grunde nach aus § 826 BGB auf Schadensersatz. Die Gegenansicht, die sowohl den Haftungsgrund als auch den Fortbestand des Schadens bestreitet, überzeugt nicht. Heese JZ 2020, 178.

Die Dogmatik der Mobiliarsicherheiten - Nachdenken über ein widersprüchliches System und seine Zukunftsfähigkeit in einem europäischen Rechtsrahmen, Festschrift für Karsten Schmidt zum 80. Geburtstag
Der europäische Binnenmarkt und der freie Handel stellen die Zukunftsfähigkeit der deutschen Dogmatik der Mobiliarsicherheiten zunehmend in Frage. Diese ist – bedingt durch ihre Entwicklungsgeschichte unter anfänglichem Ringen um Sinn und Nutzen von Publizität – hyperkonstruktiv und konfus. Der Umgang mit einzelnen Sicherungsrechten und ihren Funktionsäquivalenten im geltenden Zwangsvollstreckungs- und Insolvenzrecht ist teilweise widersprüchlich und insoweit wertungsmäßig verfehlt. Die Anerkennung und der Umgang mit publizitätslosen Mobiliarsicherheiten ist dagegen eine – vielleicht sogar die – deutsche Erfolgsgeschichte. Im Rahmen der wünschenswerten europaweiten Vereinheitlichung des Rechts der Mobiliarsicherheiten wird man mit ihr aber kaum Gehör finden, wenn man sich einer Dekonstruktion der geltenden Dogmatik und ihrer teilweisen funktionalen Neuausrichtung verschließt.
Der anlässlich des Fakultätsseminars im November 2018 gehaltene Vortrag "Die Dogmatik der Mobiliarsicherheiten - Nachdenken über ein widersprüchliches System und seine Zukunftsfähigkeit in einem europäischen Rechtsrahmen" ist erschienen in: Boele-Woelki et al., Festschrift für Karsten Schmidt zum 80. Geburtstag, 2019, Band 1, S. 409.